Jeder Millimeter zählt
Der Film hätte damals das Kino revolutionieren sollen und begann als eines der ambitioniertesten Projekte der Geschichte des französischen Films. Der detailbesessene Clouzot, damals schon berühmt für Filmarbeiten wie "Le corbeau" und "Les diaboliques", hatte einen großen Stab an Assistenten (darunter Costa-Gavras) und Technikern bekommen.
Zusammen wollten sie neue filmische Möglichkeiten in der Darstellung von Wahrnehmung, Träumen und Phantasmen ausloten, was in Zeiten analoger Kinoarbeit keine geringe Herausforderung darstellte. Clouzot selbst bezeichnete sich als Regisseur der "alten Schule", und so musste jeder Dreh bis auf den Millimeter vorbereitet werden.
Die dreifache Hölle des Henri-Georges Clouzot
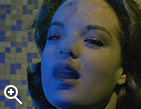 |
| ©Bild: Stadtkino |
Doch zur "Hölle" wurde das Filmprojekt am Ende auf ganz andere Weise: Clouzot trieb sich und sein Filmteam schrittweise an den Rande des Wahnsinns. Der von Schlaflosigkeit gequälte Filmemacher wollte oft in der Nacht weiterarbeiten, und nur wer ein Quartier fern vom Drehort hatte, kam nervlich über die Runden.
Drehpausen fanden so gut wie nicht statt. Am Ende reiste Reggiani, von Krankheiten gezeichnet, wortlos ab. Clouzot drehte unter schwierigen Rahmenbedingunen weiter, bis ein Herzinfarkt den Regisseur - und damit das ganze Projekt - lahmlegte.
Schwieriger Weg zur Veröffentlichung
Für Bromberg war der Weg zum Material Clouzots zunächst kein schwieriger: Es lag sortiert im Archiv. Schwierig gestaltete sich die Kooperation mit der Witwe, Ines Clouzot, die sich 40 Jahre geweigert hatte, das Material, um das sich so viele Legenden gebildet hatten, zu veröffentlichen.
Dass Bromberg die alte Dame doch überreden konnte, lag schließlich daran, dass der Filmhistoriker und die Regisseurswitwe am Ende der Verhandlungen über die Veröffentlichung in einem Lift stecken blieben und stundenlang über Clouzot weiterreden mussten.
Material, das in Versuchung führt
So kam Bromberg schließlich doch an die Tonnen an Material - und offenkundig stand er vor einer großen Versuchung beim Sichten der über 180 Filmrollen. Bromberg wollte eine Dokumentation drehen - zugleich lag so viel an belichtetem Film vor, dass man die Geschichte Clouzots gerne zu Ende gebracht, das heißt vor allem: erzählt, hätte.
Und obwohl Claude Chabrol Mitte der 90er von Clouzots Witwe das Drehbuch von "L'Enfer" gekauft hatte, rekonstruiert Bromberg, auch unter Zuhilfenahme zeitgenössischer Schauspieler, Handlung und Szenen des Films. Dabei stand der Filmhistoriker vor einer weiteren Schwierigkeit: Es gab atemraubendes Bild-, aber kein Tonmaterial.
Utopie und Wahnsinn des Kinos
Herausgekommen ist mit "L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot" eine visuell beeindruckende Arbeit über Utopie und Wahnsinn des Kinos. Man beobachtet eine 26-jährige Romy Schneider, die sich Clouzot schon bei den Probeaufnahmen ausliefert und offenbar bereit ist, jedes filmische Wagnis einzugehen.
Die Bilder, die man von Schneider in diesem Film sieht, darf man getrost als atemberaubend bezeichnen. Zwar hört man von ihr keinen einzigen Ton. Aber die Rolle der verführerischen Odette, die ihren Mann in den Wahnsinn treibt, schien ihr auf den Leib geschrieben.
Clouzot wollte seinen Film aus einem Wechsel von Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen komponieren: Bei den Sequenzen in Farbe sollte der Zuseher in den Wahnsinn Marcels mit abtauchen. Beim Dreh wurde mit der Invertierung von Farben gearbeitet. Alleine, dass sich in einer Szene der See, auf dem Odette Wasserski fährt, von einem Moment auf den anderen blutrot färbt, hatte beim Stand der damaligen Technik tagelange Vorarbeiten erfordert.
Ein Zeitdokument
Die Stärke von Brombergs Arbeit ist zweifellos die historische Rekonstruktion der Rahmenbedingung der Arbeit Clouzots. Die Assistenten, die im Film zu Wort kommen, berichten nicht nur vom alltäglichen Wahnsinn beim Dreh, sondern auch von einer Epoche, die nicht nur im Medium des Films nach gänzlich neuen Durchdringungen und Darstellungen von Wirklichkeit suchte.
Zur selben Zeit blühte in Frankreich ja der "Nouveau roman" - und die enge Koppellung zwischen literarischer und filmischer Arbeit, etwa beim Duo Alain Robbe-Grillet und Alain Resnais, hat auch für eine Schule der Wahrnehmung ganz neue Ansätze geliefert. Clouzot hat den Raum der damaligen Debatten erweitert. Er schien sich am europäischen wie am amerikanischen Kino zu orientieren. Was ihm aber offenbar fehlte, war die ordnende Hand eines Produzenten, der die kreativen Prozesse der Filmarbeit zusammenhielt.
Gerald Heidegger, ORF.at
Kinohinweis
Die Dokumentation "Inferno: L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot" läuft ab Freitag in den heimischen Kinos. Der Film wurde auf der Viennale im Herbst 2009 in Österreich vorgestellt.
Links: