So will es die gängige Mär, dass der Mönch Dom Perignon im 17. Jahrhundert in der französischen Champagne ein begnadeter Weintüftler war und voll Begeisterung den Champagner erfand. Ekstatisch soll er einem Mitbruder zugerufen haben: "Komm schnell! Ich trinke die Sterne."
Eiszeit statt Heldengeschichte
Die Wahrheit sieht anders aus und hat viel weniger mit einer typisch männlichen Heldengeschichte zu tun. Denn die Erfindung des moussierenden Weins war nicht mehr als ein Unfall, und bei der weltweiten Verbreitung spielten Frauen eine entscheidende Rolle.
Ein unerwünschtes Nebenprodukt
Aber wie kamen die Perlen nun wirklich in den vergorenen Traubensaft? Verantwortlich dafür war eine kleine Eiszeit, die in den Wintern zwischen 1560 und 1730 den Gärungsprozess, der Traubenmost zu Wein macht, häufig zum Erliegen brachte.
Normalerweise wurde der Wein in unversiegelte Fässer gefüllt, wobei die Hefe in den Traubenschalen den Fruchtzucker umzuwandeln begann. Dabei entstanden Alkohol und Kohlendioxid, das in die Luft entwich. Wenn die Gärung abgeschlossen war und die Hefezellen abstarben, wurde der Wein in luftdichte Fässer umgefüllt, wo er weiter reifen konnte.
Doch in den eisig kalten Wintern des 17. Jahrhunderts wurden die noch lebenden Hefekulturen in den neuen Fässern wieder aktiv und produzierten weiter Kohlendioxid. Dieses konnte nicht entweichen - deshalb perlte der erste Champagner.
So wird im Prinzip noch heute Schaumwein hergestellt: Wein durchläuft in einer Flasche einen zweiten Gärungsprozess. Zunächst jedoch empfand man das als unerwünschten Nebeneffekt und leerte das "Teufelszeug" weg.
Dom Perignons Mission
In den Fässern perlte der Wein nicht so prickelnd wie in Flaschen - und nur die besten Tropfen gewannen durch das Kohlendioxid an Qualität. Dom Perignon experimentierte deshalb ein Jahrzehnt lang mit nur einem Ziel: die Entstehung der Bläschen zu stoppen.
Erst nach und nach, noch dazu früher in Großbritannien als in Frankreich, lernten Weinliebhaber Schaumwein zu schätzen, unter anderem, weil sich mehr und mehr die Flasche gegen das Fass durchsetzte. Im 18. Jahrhundert schließlich trat auch der französische Champagner seinen Siegeszug an.
Die Witwe Clicquot
Dafür war vor allem eine Frau verantwortlich: Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin. Die im Jahr 1777 geborene Tochter eines wohlhabenden Textilunternehmers übernahm nach dem frühen Tod ihres Gatten im Alter von nur 28 Jahren den Weinhandel von dessen Familie.
Zunächst musste sie vier Jahre lang mit einem Partner an ihrer Seite arbeiten, um den Schwiegervater von ihrem wirtschaftlichen Geschick zu überzeugen - was ihr aber nicht schwerfiel. Die junge Witwe (auf Französisch: "veuve") erfand neue Herstellungsverfahren und mauserte sich zu einer der ersten großen Frauen der Wirtschaftsgeschichte.
Champagner an die Höfe gebracht
Durch ihren persönlichen Einsatz gelang es ihr, trotz der Misere Europas nach den napoleonischen Kriegen für einen internationalen Champagner-Boom zu sorgen. Sie stellte ihren Schaumwein an zahlreichen Herrscherhöfen in ganz Europa vor und exportierte sogar heimlich nach Russland.
In der Geschichtsschreibung verschwiegen
Die Historikerin Mazzeo listet in ihrem Buch noch weitere Frauen auf, die die Geschichte des Champagners entscheidend prägten. Gemeinsam sei ihnen, dass ihre Bedeutung in der Geschichtsschreibung unterspielt werde.
Über Clicquot-Ponsardin etwa werden zwar in der Region Champagne noch heute zahlreiche Geschichten erzählt, und die überlieferte Buchführung des Unternehmens listet ihre Verdienste akribisch auf.
Viel Fantasie
An gesichertem historischem Material über diese Frau, die zu Lebzeiten weit über die Grenzen Frankreichs hinaus berühmt war, ist allerdings nur wenig zu finden. Das merkt man auch dem Buch an. Mazzeo füllt viele Lücken mit Fantasie. Immer wieder sind spekulative Passagen zu lesen - die aber auch als solche ausgewiesen sind.
In der Kulturgeschichte spielt die Unternehmerin jedenfalls eine Rolle, zumindest eine kleine in Wilhelm Buschs "Die fromme Helene": "Wie lieb und luftig perlt die Blase /
Der Witwe Klicko in dem Glase!"
Buchhinweis
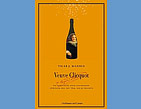 |
Link:
- Veuve Clicquot (Hoffmann und Campe)