Tausende Exemplare
Im Mittelpunkt steht die zur Geburtsstunde Deutschlands verklärte "Schlacht im Teutoburger Wald", bei der vor genau 2.000 Jahren die Krieger des Cheruskers Arminius drei Legionen des Römers Varus niedermetzelten und so den Drang Roms nach Germanien dämpften.
Die Ausstellung zeigt bis 25. Oktober in den drei Museen Tausende Exponate vom römischen Schuhnagel bis zum weltbedeutenden antiken Kunstwerk, vom nationalistischen Schlachtengemälde des 19. Jahrhunderts bis zur Wollkleidung germanischer Moorleichen.
Steile Karriere
Die Geschichte des Feldherrn Varus wird in Haltern lebendig. Außerdem wird der Aufstieg Roms vom Dorf auf den Sieben Hügeln zur Weltmacht dokumentiert. Eine Handvoll winziger Bronzemünzen zeigt ein zeitgenössisches Porträt von Varus.
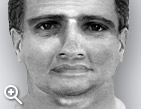 |
| ©Bild: LKA NRW |
In der Mitte eines hell erleuchteten Raums steht eine Statue von Apollo, dem Gott der schönen Künste. Die dunkle Seite in der Karriere des Römers belegt die Nachbildung eines von einem Nagel durchbohrten Fersenbeins eines Gekreuzigten, den wohl Varus als Statthalter des Imperiums in Palästina hatte hinrichten lassen.
Germanische Plünderungen
Die Schätze der germanischen "Barbaren" und ihre Welt sind das Thema in Kalkriese, dem möglichen historischen Ort der Varus-Niederlage. In einem Moor entdeckte menschliche Überreste zeugen von den Dauerkriegen unter den Germanen.
Da es aus dieser Zeit keinerlei schriftliche Quellen gibt, sind diese Funde von unschätzbarem archäologischem Wert. So stehen die Besucher vor Vitrinen mit Pfeilspitzen, Schwertern und anderen germanischen Waffenresten.
Ein wesentliches Motiv für Konflikte war die Eroberung von Beute. Das zeigt sich am Alemannenschatz von Neupotz aus Schmuck, Töpfen, Kesseln und Waffen, der die Plünderungen der Germanen über den Grenzwall Limes hinweg tief ins Römische Reich hinein dokumentiert.
Kritischer Blick
In Detmold, der Stadt, in der das Hermannsdenkmal aus dem 19. Jahrhundert steht, wird der nationale Mythos um die Varusschlacht kritisch beleuchtet, der mit Opern, in der Literatur (etwa bei Heinrich von Kleist) und der Kunst Generationen überdauert hat.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Ausstellungskapiteln wartet Detmold mit weitaus mehr als archäologischen Funden auf. Von der Händel'schen Originalpartitur seiner Oper "Arminio" über monumentale Schlachtengemälde des 19. Jahrhunderts bis hin zum touristisch-kitschigen Gartenzwerg reicht das Angebot.
Gegen Vereinnahmung
Angesichts des Themas sind die Veranstalter vorsichtig: Die Museumsmitarbeiter seien vom Staatsschutz entsprechend geschult worden, mögliche Aktivitäten rechtsradikaler Besucher erkennen und unterbinden zu können, sagte ein Sprecher. Auch das Hermannsdenkmal in Detmold stehe unter Beobachtung.
Link: