Waren große Kunstwerke bis zum Zeitalter von Fotografie und Impressionismus nicht gerade vom Anspruch einer möglichst perfekten Nachahmung von Wirklichkeit, von der oft zitierten "Abschrift der Natur", getrieben - und gerade Maler jene Zeitgenossen mit dem privilegiertesten Sehsinn?
"Es scheint mir", so Gombrich zum Ausgangspunkt seiner Forschung, "dass wir unsere Fähigkeit, Bilder zu deuten, das heißt, die Geheimschrift der Kunst zu entziffern, gewöhnlich als viel zu selbstverständlich nehmen."
Unsere Augen seien an Konventionen des Sehens gewöhnt, hielt Gombrich der Auffassung eines "unschuldigen Blicks" entgegen. Und nichts, was uns in der Kunst als naturnah begegne, sei tatsächlich naturnah. Die Schaffung künstlerischer Illusion ist ein komplexer Vorgang, und mit großer Liebe zitiert Gombrich den großen englischen Landschaftsmaler John Constable, für den die Malerei eine "Wissenschaft, eine Erforschung von Naturgesetzen" gewesen sei "und als solche betrieben werden sollte".
 |
| "Echte" Natur? John Costable, Wivenhoe Park |
Warum "sehen" wir zu manchen Zeiten anders?
Für Gombrich ist in der Menschheitsgeschichte von den Griechen bis zur Gegenwart das gleiche Grundpotenzial zur Darstellung einer wahrgenommenen Wirklichkeit vorhanden. Zu klären galt für ihn, warum sich bestimmte Darstellungsweisen nicht zu jeder Zeit durchsetzen - oder technisch verwirklichen - ließen. Mit einer Serie von Vorlesungen an der National Gallery in Washington zu diesen Fragestellungen legte Gombrich die Grundlagen, die schließlich in sein Hauptwerk mündeten: "Kunst und Illusion. Eine Psychologie der bildlichen Darstellung" (1960).
Was passiert mit unserer Wahrnehmung?
Wahrnehmung wird für Gombrich gesteuert von konventionellen "Schemata", von Denk- und Empfindungsvoraussetzungen und nicht zuletzt von technischen Rahmenbedingungen, die sich immer an der Gegenwart abarbeiten. Die Auffassung, es gebe Phasen primitiver und hochentwickelter Kunst, hielt er für überholt.
Schon die Griechen, so Gombrich, hätten durch die Abstufung ihres Farbsystems, etwa in der Vasenmalerei, das Prinzip der Dreidimensionalität gekannt.
Das Auge funktioniert für Gombrich wie ein ständig überprüfendes und korrigierendes Organ, das die künstlerische Freiheit und Fantasie mit neuen Problemsituationen und Hypothesen konfrontiert. "Die Wahrnehmung erbringt hypothetische Setzungen, die gesellschaftliche Bedürfnisse zeitweise befriedigen, aber von neuen Erwartungen infrage gestellt werden können", schrieb Martin Warnke in der "Zeit" über Gombrichs Standardwerk.
Die Betrachter wiederum wiederholen für Gombrich in der Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk die Bedingungen seiner Entstehung: Auch sie arbeiten mit Vermutungen, Erkundungen, der Erprobung von Hypothesen, dem Verwerfen von Irrtümern und vielem mehr.
"Intensives Betrachten macht noch keinen Maler"
"Alle Künstler bestätigen, dass sie durch intensives Betrachten der Natur lernen. Aber ebenso ist es sicher, dass noch niemand durch intensives Betrachten der Natur zum Maler wurde", erklärt Gombrich in "Kunst und Illusion".
Gombrich zeigt sich inspiriert von den englischen Sensualisten, aber auch von seinem Landsmann und Freund Karl Popper, der steter Gewährsmann in seinen Arbeiten ist. "Ich wäre stolz darauf, wenn Professor Poppers Einfluss auf jeder Seite dieses Buches zu spüren wäre, aber selbstverständlich ist er für dessen Schwächen nicht zuständig", schreibt Gombrich im Vorwort zu "Kunst und Illusion". Poppers Theorie über die Falsifizierung von Hypothesen verlegt Gombrich in die Arbeit des Künstlers ebenso wie in die des Betrachters.
Großes Wissen, noch größere Breitenwirkung
Bemerkenswert an diesem wie auch an allen anderen Werken Gombrichs bleibt die Breitenwirkung, die er mit seinen Überlegungen zu erzielen vermag. Hier schreibt jemand mit der Utopie von universalem Wissen ohne je belehrend oder unverständlich zu sein.
Gombrichs Hauptwerk wirkt zugleich wie die Summe seiner Biografie, erzählt es doch auch von einer untergegangenen Welt (auch von einem in dieser Form nicht mehr existierenden Österreich). Hier schreibt jemand, der Ende der 1920er Jahre an der Universität Wien bei Julius von Schlosser, Hans Tietze und Emanuel Loewy eine klassische, solide Ausbildung im Feld der Kunst und Archäologie bezogen und zugleich das geistige Klima Wiens der 20er und frühen 30er Jahre tief inhaliert hatte. Bei Gombrich kreuzen sich Psychoanalyse, Gestalttherapie, Verhaltensforschung und logische Philosophie.
Wer liest noch Cicero?
Die Frage, ob das Bildungsbürgertum eine aussterbende Spezies sei, beantwortete Gombrich zwei Jahre vor seinem Tod so: "Meine Eltern leben selbstverständlich in einer anderen Bildungswelt als wir. Aber das gehört zur natürlichen Abfolge der Generationen. Ich war sehr befreundet mit Karl Popper. 'Who reads still Cicero?', hat er mich am Telefon gefragt. Na, ich lese ihn doch, habe ich geantwortet. Aber wer sonst?"
"Ich bin das, was Hitler einen Juden nannte"
Dass Gombrich vor den Nazis aus seiner Heimat fliehen musste, empfand der Weltenbürger immer als aufgezwungenes Schicksal - auch weil er als Sohn eines Anwalts und einer Konzertpianistin, die zum Protestantismus konvertiert waren, nie über seine jüdische Identität reflektieren musste.
"Wenn es nach dem geht, was vielleicht fromme Juden einen Juden nennen, wäre ich kein Jude", hielt Gombrich 1999 in einem Interview fest. "Aber wenn man heute gefragt wird, sagt man selbstverständlich: Ja, ich bin Jude. Die richtige Antwort wäre: Ich bin das, was Hitler einen Juden genannt hat."
Vor seiner Emigration schrieb Gombrich, quasi als Fingerübung, eine "Kurze Weltgeschichte für junge Leser", die der DuMont Verlag jüngst wieder aufgelegt hat. In London, Gombrichs neuer Heimat, wartete, unterbrochen durch den Krieg, die Aufarbeitung des Nachlasses des großen Aby Warburg - wie Gombrich ein Grenzgänger zwischen Kunst- und Kulturgeschichte. Als Direktor des Warburg-Instituts wurde Gombrich schließlich zur international geachteten Institution, der vor allem über die Grenzen seines Faches wirkte.
Gombrich und die Folgen
Innerhalb der Kunsttheorie machte sich Gombrich nicht nur Freunde. Vor allem Arthur C. Danto kritisierte, dass Gombrich die weniger an der Optik ausgerichteten Strömungen der modernen Kunst, etwa Marcel Duchamps Leistungen, vollkommen ausgeklammert habe. Das, so Danto, schränke die Leistungskraft von Gombrichs Theorie der bildlichen Repräsentation ein.
Auf der anderen Seite nahm dafür der kanadische Philologe Herbert Marshall McLuhan Gombrichs Beobachtungen in "Kunst und Illusion" gerade im Bereich der modernen Kunst begeistert für seine Medientheorie auf. Den Satz "Das Medium ist die Botschaft" untermauerte McLuhan jedenfalls mit den Beobachtungen Gombrichs zur Kunst des Kubismus.
Der Kubismus, so McLuhan, setze alle Aspekte eines Gegenstandes gleichzeitig - anstelle des "Augenpunktes" oder der perspektivischen Illusion: "Der Kubismus gibt Innen und Außen, Oben, Unten, Hinten, Vorne und alles Übrige in zwei Dimensionen wieder und lässt damit die Illusion der Perspektive zugunsten eines unmittelbaren sinnlichen Erfassens des Ganzen fallen. Mit diesem Griff nach dem unmittelbaren, totalen Erfassen verkündete der Kubismus plötzlich, dass das Medium die Botschaft ist."
Ein ständiger Grenzgang
Gombrich wird diese Weiterverarbeitung außerhalb seines Faches kaum gewundert haben. Er selbst hatte seine Theorie immer als offenen Grenzgang zwischen den Disziplinen angelegt (und dabei auch bekennen müssen, nicht jede Beobachtung wissenschaftlich stringent beantworten zu können).
Anregungen, etwa zur Erläuterung der Perspektive in der Renaissance, holte er sich im Bedarfsfall von Dramentheorie und Predigtliteratur. Und wenn es darum ging, die Rolle des Gehirns bei der Umwandlung gesehener in dargestellte Wirklichkeit zu befragen, hatte Gombrich einen großen Politiker (und leidenschaftlichen Hobbymaler) zur Hand: Winston Churchill und seine Idee vom "mentalen Postamt", das die geschaute Wirklichkeit auf dem Weg zur Leinwand einmal passieren muss.
Gerald Heidegger, ORF.at
Buchhinweise
 |
Ernst H. Gombrich: Kunst und Illusion. Zur Psychologie der bildlichen Darstellung. Phaidon Verlag, 386 Seiten, 25,70 Euro.
 |
Ernst H. Gombrich: Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. Von der Urzeit bis zur Gegenwart: Du Mont, 335 Seiten, 13,30 Euro.
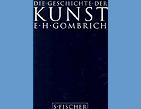 |
Gombrichs "Geschichte der Kunst", zuletzt erschienen bei S. Fischer, ist im Moment vergriffen.
Veranstaltungen zum 100. Geburtstag Gombrichs
Aus Anlass des 100. Geburtstages von Gombrich findet eine Reihe von Veranstaltungen und wissenschaftlichen Vorträgen statt.
- Vorträge von Charles Hope und Raphael Rosenberg am Institut für Kunstgeschichte der Uni Wien am Montag um 18.00 Uhr, Campus Altes AKH, Hof 9, 1090 Wien.
- Vortrag von Arthur Rosenauer am 2. April um 18.30 Uhr im Bassano-Saal des Kunsthistorischen Museums Wien, Burgring 5, 1010 Wien.
- Internationales Symposion "E. H. Gombrich auf dem Weg zu einer Bildwissenschaft des 21. Jahrhunderts" am Montag und Dienstag in Greifswald, ausgerichtet von der Alfried-Krupp-Stiftung und dem Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg.
Links: