Mitarbeitern der von der US-Armee angeheuerten Unternehmen Titan Corp. und CACI International werden unter anderem sexuelle Übergriffe und andere Formen von Misshandlungen vorgeworfen.
Klage von einem Dutzend Ex-Häftlingen
Angestrengt wurde die Klage von einem Dutzend ehemaliger Abu-Ghoraib-Häftlinge aus dem Irak und von den Hinterbliebenen eines Irakers, der in dem Gefängnis gestorben war.
Die beiden Firmen hatten der US-Armee Verhörspezialisten und Dolmetscher zur Verfügung gestellt.
CACI bietet "Kommunikationslösungen"
CACI ist ein in Arlington im Bundesstaat Virginia ansässiges und an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen, das laut Eigendefinition "Informationstechnologie und Kommunikationslösungen" liefert. Die Holding CACI International hat Niederlassungen in den USA und Europa.
Private kaum kontrollierbar
Der Einsatz privater Sicherheitsfirmen wird derzeit in den USA im Zusammenhang mit dem Skandal um die Firma Blackwater heftig diskutiert.
Die privaten Dienstleister sind praktisch kaum kontrollierbar, weil sie in einem rechtsfreien Raum agieren. Die US-Übergangsverwaltung gewährte ihnen nach der Besetzung des Irak 2003 im "Dekret 17" Immunität, wie sie weltweit auch Diplomaten genießen.
Mit Strom gefoltert
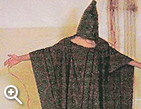 |
| ©Bild: AP/- |
An seinem Körper wurden Stromkabel befestigt - genau wie bei jenem unbekannten Iraker in Abu Ghoraib, dessen Bild um die Welt ging und auf den Titelseiten politischer Magazine im Westen gedruckt wurde.
"Der Alptraum hängt mir nach"
Der 42 Jahre alte Iraker will Schadenersatz von CACI International und Titan.
"Seit ich im Jänner 2004 freikam, hatte ich keinen frohen Tag", berichtet Schalal. "Der Alptraum, den ich durchgemacht habe, hängt mir nach. Noch schlimmer ist es, die Gerichtsverfahren der Folterer zu sehen, ohne dass eines der Opfer Gerechtigkeit verlangen kann."
"Fotos hatten guten Zweck"
Schalal findet, dass die bisherigen Urteile gegen die Verantwortlichen des Skandals zu milde ausgefallen seien. Dass die Soldaten Fotos von ihm schossen, bekam Schalal manchmal mit. "Sie fotografierten mich, als ich gerade nackt war. Ich murmelte Koranverse und wünschte, ich würde sterben."
Heute ist er der Überzeugung, dass die Bilder bei aller Demütigung auch einen guten Zweck hatten: "Sie haben die Skeptiker von der Wirklichkeit überzeugt. Vorher haben uns viele Leute nicht geglaubt."
Lynndie England als Symbol
Der Skandal wurde 2004 durch die Veröffentlichung von Fotos ausgelöst, auf denen misshandelte Häftlinge des US-Gefängnisses zu sehen waren. Sie sorgten weltweit für Empörung.
In einer Art Grauzone trieb eine Gruppe von US-Militärpolizisten - offenbar gemeinsam mit Angestellten von privaten Sicherheitsdiensten - ihr Unwesen und demütigte, misshandelte und folterte Gefangene.
Zum Symbol wurde die US-Soldatin Lynndie England, die sich mit einem nackten Häftling fotografieren ließ, den sie an einer Hundeleine führte. England wurde später zu drei Jahren Haft, der Rädelsführer der Gruppe, Charles Graner, zu zehn Jahren verurteilt. Die für die Aufsicht der Gefängnisse zuständige US-Generalin Janis Karpinski wurde degradiert.
"Eine Handvoll fauler Äpfel"
Die US-Regierung sprach nach Bekanntwerden des Skandals von einer Handvoll fauler Äpfel, die dem Ansehen der USA und ihrer Armee schwer geschadet hätten. Die Verurteilten sahen sich zu Sündenböcken gestempelt und gaben an, auf Befehl gehandelt zu haben.
Menschenrechtsgruppen haben beklagt, dass bei der Suche nach den Schuldigen nicht die ganze Befehlskette bis zum Pentagon und Weißen Haus verfolgt worden sei.
Links: